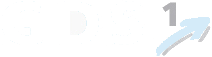Konzeption der Persönlichkeitsbildung
Grundlage der Lehrplanarbeit ist, wie bei der Startveranstaltung am 18.4.2011 an der GDS 1 vorgestellt, die
Curriculare Konzeption
des Baden-Württembergischen Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport (Bildungsplan für die Fachschule Band I, Heft 1 und 5), zweijährigen Fachschulen, gewerblich-technischer Fachrichtungen
Fachrichtung: Farb- und Lacktechnik neu: Industrielle Beschichtungstechnik
auf der Grundlage der von der
Kultusministerkonferenz (KMK) beschlossenen Rahmenvereinbarung.
Als Diskussionsgrundlage für die beteiligten Kollegen an der GDS1 dienen zudem Auszüge weiterer Ministerien, so zum Beispiel von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bayern sowie das Konzept zur Technikerausbildung in Singapur (Technical Engineer Diploma).
Die Unterrichtsfächer „Deutsch/Kommunikation“, „Fremdsprache“, „Betriebswirtschaftslehre“ sowie „Mitarbeiterführung/Berufs- und Arbeitspädagogik“ sind integraler Bestandteil des Lernens innerhalb des beruflichen Bildungsganges. Diese Fächer bewirken dabei eine Aspekterweiterung des Lernens für die übrigen Unterrichtsfächer. Sie tragen zur Entwicklung beruflicher Handlungskompetenz und auch zur Persönlichkeitsbildung bei, indem sie berufliche Erfahrungen unter sprachlich-kommunikativen, wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialwissenschaftlichen Perspektiven analysieren und anreichern. Sie fördern damit ein positives Verständnis hinsichtlich der Gestaltbarkeit organisatorischer, technischer und ökonomischer Entwicklungen.
Die Auswahl konkreter Problemstellungen für die Arbeit und Zusammenarbeit dieser Fächer erfolgt in den Fachkonferenzen der einzelnen Schulen. Sie orientiert sich an den Lernenden, den Fachrichtungen mit ihren Schwerpunkten und regionalen Besonderheiten.
In den vorgenannten Fächern steht die Entwicklung von Kompetenzen im Mittelpunkt, die über den einzelfachlichen Bereich hinausgehen wie Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Kreativität, Fähigkeit, Problemlösetechniken bewusst einzusetzen, Kritikfähigkeit, systematisches, vernetztes Denken, Verantwortungsbewusstsein, Gestaltungsfähigkeit und Handlungsfähigkeit.
Dies erfordert auch die Kenntnis und Nutzung z. B. von Lerntechniken, Präsentationstechniken, Gruppenarbeitstechniken und modernen Kommunikationstechniken.
Für die Absolventinnen und Absolventen von Fachschulen lassen sich übergreifende berufliche Handlungsfelder und daraus abgeleitet Handlungssituationen beschreiben, die Grundlage einer Fächerintegration sein können.
Eine Fächerintegration ist dann sinnvoll, wenn in die entsprechende Handlungssituation in exemplarischer Weise wesentliche Methoden und Problemstellungen eines Faches eingebunden werden können. Eine zwanghafte Integration um des bloßen Prinzips willen ist nicht sinnvoll.
Die Handlungsfelder bzw. die Vorschläge für Gruppenarbeiten/Produkte sind durch Teams von Lehrerinnen und Lehrer der beteiligten Fächer lerngruppenspezifisch auszulegen. Dabei sind die spezifischen Erfahrungen und Arbeitsfelder der Fachschülerinnen und Fachschüler einzubeziehen. Das Team der Unterrichtenden wird im Vorlauf zum Unterricht die für möglichst selbständigen Problemlösungen notwendigen Materialien, Leittexte, usw. zusammenstellen. Die Einbindung der Fächer „Deutsch/Kommunikation“, „Fremdsprache/Kommunikation“, „Betriebswirtschaftslehre“ sowie „Mitarbeiterführung/Berufs- und Arbeitspädagogik“ in berufliche Bildungsgänge erfordert eine bildungsgangspezifische Konkretisierung der Handlungssituation. Dies kann in der Mehrzahl der Fälle nur in Zusammenarbeit mit den übrigen Fächern erfolgen. Darum ist besonderer Wert auf die Zusammenarbeit mit diesen Fächern zu legen.